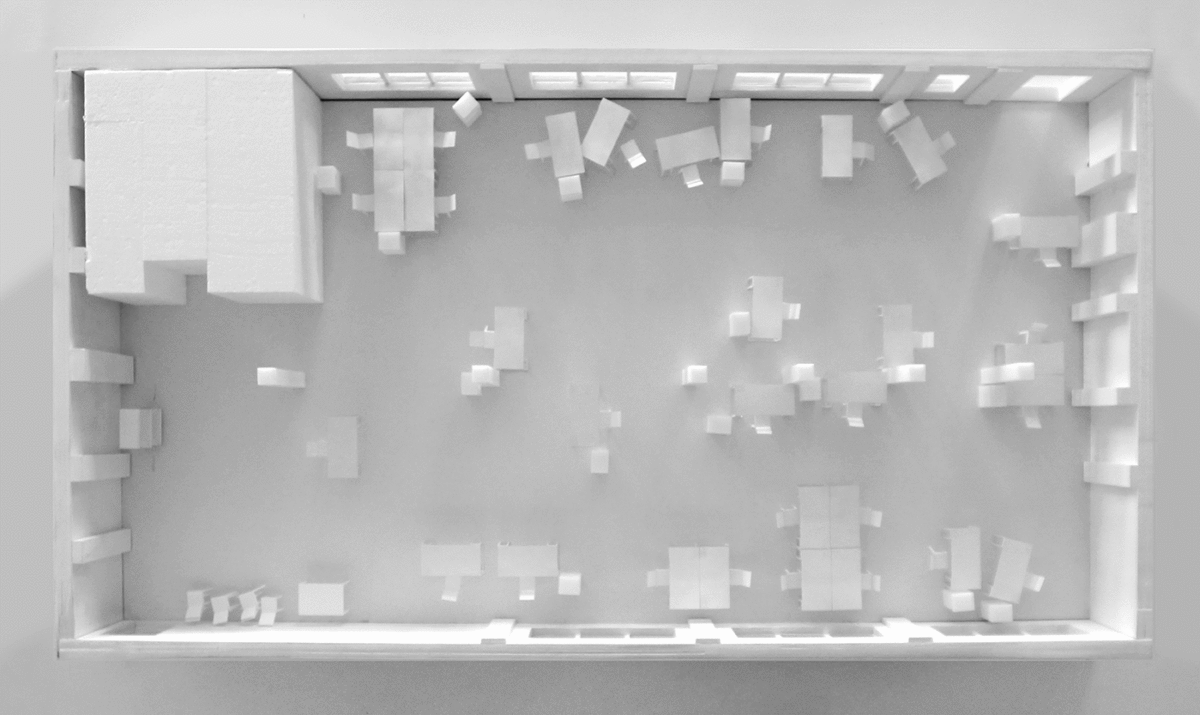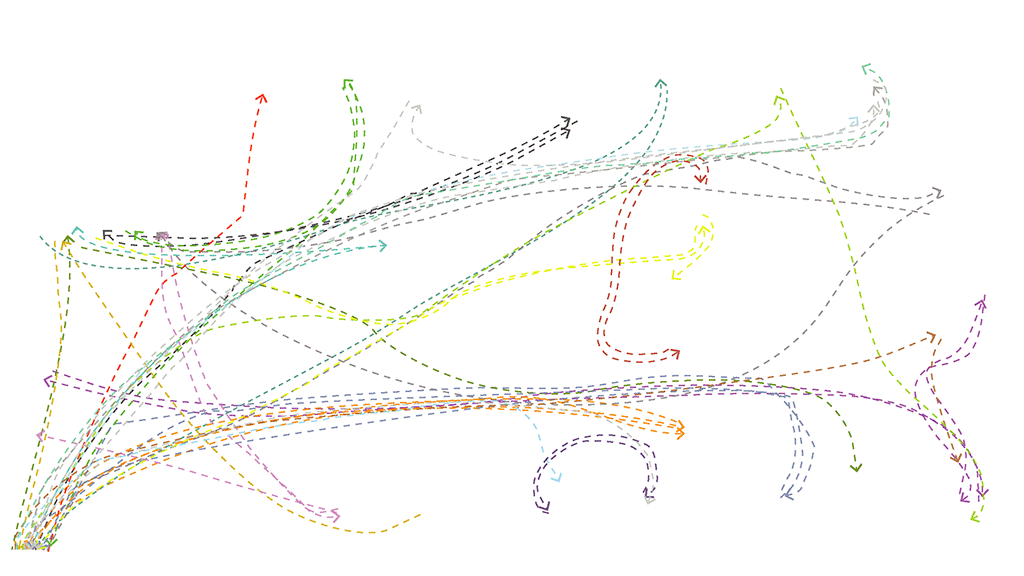Der Raum hat messbare Auswirkungen auf die Gruppendynamik
Das ArchiExp-Team hat Erfahrung mit der Untersuchung des Einflusses von Räumen auf Wissensproduktion. Hervorgegangen ist die Forschungsgruppe aus dem Exzellenzcluster „Bild Wissen Gestaltung“, das von 2012 bis 2018 an der Humboldt-Universität mehr als 40 verschiedene Disziplinen zusammenbrachte. Im Zentrum stand die Untersuchung von Bildern, Objekten und Wissen als Gestaltungsprozesse. Erstmalig kamen in der Grundlagenforschung dabei neben Geistes-, Natur- und Technikwissenschaften und Medizin auch Gestaltungsdisziplinen wie Design und Architektur zusammen.
Teil des Forschungsteams ArchitekturenExperimente waren auch Expert*innen aus weiteren Fachbereichen, darunter Wolfgang Schäffner (Kulturwissenschaften), Finn Geipel (Architektur) und Jörg Niewöhner (Europäische Ethnologie). Ausgangspunkt ihrer Forschung war die Frage, wie die Arbeit gemeinsam zwischen verschiedenen Fachbereichen funktionieren kann – und welche Rolle der Raum dabei spielt. „Wir wollten wissen: Wie können wir unsere physische und digitale Clusterarchitektur so gestalten, dass sie interdisziplinäre Forschungsprojekte unterstützen kann“, erklärt Henrike Rabe.
Um das herauszufinden, wurde die Experimentalzone gegründet. „Startpunkt war ein 350 Quadratmeter großer Gebäudeflügel, in dem wir alle Trennwände herausgerissen und so eine flexible Fläche geschaffen haben“, erzählt die Architektin. Dieser von Wissenschaftler*innen und Gestalter*innen aus vielen unterschiedlichen Disziplinen genutzte Arbeitsort wurde in regelmäßigen Abständen verändert und umgebaut. „Wir haben mit vielen verschiedenen Beobachtungsmethoden untersucht, was das mit den Forschungspraktiken macht“, erklärt Rabe. Dabei wurden die individuellen physisch-digitalen Forschungspraktiken in den Blick genommen, aber auch wie diese im Raum aufeinandertreffen. „Vor allem aber hat uns interessiert, wie sich aus einem Nebeneinander-Arbeiten ein Miteinander-Arbeiten entwickelt“, sagt Henrike Rabe.
Die Untersuchung erstreckte sich über einen Zeitraum von drei Jahren. Im Ergebnis ist das Konzept des “kollaborativen Habitats” entstanden – einem Raum, der Interdisziplinarität fördert. In der Monografie „Experimental Zone“ wird beschrieben, was solch einen Raum ausmacht. Es habe sich unter anderem gezeigt, dass offenere Raumtypologien deshalb so förderlich für die Zusammenarbeit sind, weil sie eine graduelle Annäherung zwischen den Disziplinen ermöglichen. “Durch die Sichtbarkeit der unterschiedlichen Praktiken zum Einen, und der Work-In-Progress-Forschungsinhalte zum Anderen, können sich die Wissenschaftler*innen den fremden Praktiken und Inhalten Schritt für Schritt annähern”, sagt die Architektin. Es gab aber auch kontraintuitive Einsichten: Heutzutage gebe es einen Trend hin zum flexiblen Arbeiten, bei dem Schreibtische gewechselt werden. „Wir haben aber beobachtet, dass es vielen wichtig war, sich einen festen Arbeitsplatz einzurichten – zunächst vor allem einzeln, später immer mehr in Gruppen. Diese Verankerung bot zum einen Schutz im offenen Raum und erlaubte zum anderen den schnellen Abruf von praktik-spezifischen Assemblagen“, erzählt Rabe.
Neben dem universitären Kontext sind für das ArchiExp-Team auch andere „Architekturen des Wissens“ interessant: Gebäude, in denen Wissen produziert, vermittelt oder gespeichert wird. Dazu gehören Schulen, aber auch Ausstellungsorte wie das Humboldt Labor. „Architekten gehen oft im Entwurfsprozess davon aus, dass man mit Räumen Wissensproduktion fördern oder Interaktionen ankurbeln kann. Aber systematisch erforscht wurde das wenig – und erstaunlicherweise kaum in Zusammenarbeit mit Soziolog*innen und Ethnolog*innen“, sagt Henrike Rabe. Die Kurator*innen des Humboldt Labors erhoffen sich von diesem Forschungsprojekt Ideen für die Zukunft, erzählt Friedrich von Bose. „Es geht auch darum, konkrete gestalterische Impulse für zukünftige Ausstellungssettings zu entwickeln.“